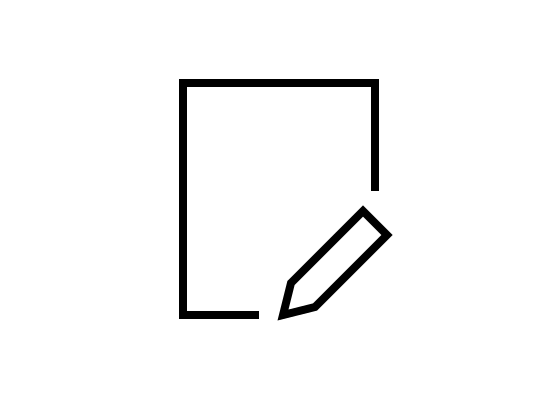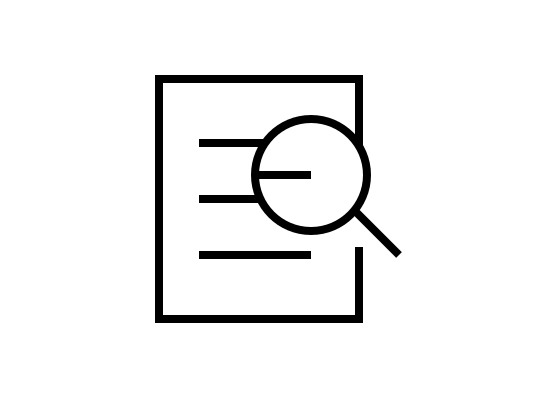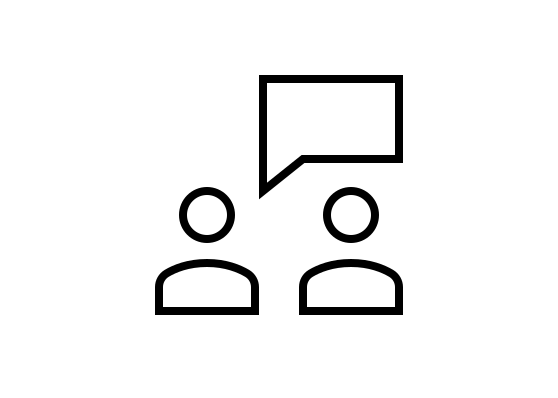Darüber zu entscheiden, welche Projekte letztlich mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet werden, ist bei der Fülle an vielversprechenden Einreichungen keine einfache Aufgabe. Der Jurysitzung geht daher ein erstes Auswahlverfahren voraus, in dem Fachleute des Umweltbundesamtes gemeinsam mit dem Projektbeirat bestehend aus Designer*innen und wissenschaftlichen Expert*innen überprüfen, ob und in welchem Maße die hohen Gestaltungs- und Umweltansprüche erfüllt werden.
Über ihren fachlichen Blick auf die eingereichten Beiträge hinaus wirken die Mitglieder des Beirats als Multiplikatoren. Sie tragen dazu bei, das Thema Ecodesign in der Lehre und in ihren Branchen zu verankern und den Wettbewerb bekannter zu machen. Mareike Gast ist Professorin für Industriedesign, Material und technologiebasierte Produktentwicklung an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und erklärt im Kurz-Interview, worauf sie bei ihrer Bewertung achtet.
Bitte erzählen Sie uns ein wenig von Ihnen und Ihrer Arbeit. Was tun Sie, was treibt Sie in Ihrem täglichen Job an?
Ich bin Industriedesignerin mit einer Faszination für Materialien, Technologien und Nachhaltigkeit. Material- und technologiebasierte Produktentwicklung ist der Schwerpunkt, in dem ich seit 2016 als Professorin an der Burg Giebichenstein in Halle unterrichte. Salopp gesagt, zielen die Veranstaltungen und Entwurfsprojekte zunächst darauf ab, ein Grundverständnis über Materialien, Technologien und Nachhaltigkeit zu vermitteln. Dieses Wissen um die große Bandbreite und auch die dahinterliegenden Potenziale und Risiken von Materialien und Technologien können die Student*innen frühzeitig in ihre Entwürfe einfließen lassen. Schlussendlich geht es aber weit darüber hinaus – nämlich darum, Kontexte zu verschieben bzw. Grenzen neu auszuloten – zum Beispiel ein Material in einer eher ungewöhnlichen Technologie zu verarbeiten und neue Nutzungsstrategien zu entwickeln, um so Anwendungen zum Beispiel im Hinblick auf Kreislauffähigkeit zu ermöglichen. Dazu braucht es eine mutige und experimentelle Auseinandersetzung. Und das im besten Fall nicht im stillen Kämmerlein, sondern im interdisziplinären Diskurs. Die Designdisziplin begreife ich auch als eine Schnittstellendisziplin, die viele andere Disziplinen zusammenbringen kann, um die daraus entstehenden Potenziale in ganz konkrete Möglichkeiten, also Produkte oder Konzepte, zu übersetzten, sodass diese dann diskutierbar und anwendbar sind.
Was sind für Sie als Designexpertin die wichtigsten Aspekte, die im Designprozess mitgedacht werden sollten? Auf welche Kriterien legen Sie bei der Bewertung einer Einreichung am meisten Wert?
Ganz entscheidende Faktoren bei der Bewertung sind für mich Konsequenz und Transparenz. Überzeugendes Design entsteht, wenn der Grundgedanke hinter einer Idee konsequent umgesetzt und dabei mutige und vor allem bewusste Entscheidungen getroffen werden. Im Gestaltungsprozess ergeben sich irgendwann immer Zielkonflikte, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Sobald man sich für einen Weg entscheidet, gehen damit zwangsläufig Defizite auf einer anderen Seite einher. Und genau hier ist Transparenz enorm wichtig. Es ist kein Makel zu sagen: „Ich habe das erreicht, aber ich musste dafür einen Kompromiss eingehen und hier ist noch etwas ungelöst“. So ein offener Umgang sollte in unserer Gesellschaft gefördert werden. Am Ende sind es iterative Prozesse, mit deren Hilfe gemeinsam nach und nach verändert, verbessert, adaptiert, variiert werden kann. Wenn aber ungelöste Aspekte oder Kompromisse verschleiert werden, wird nicht nur das Vertrauen der Konsument*innen gemildert, sondern auch der oder dem Nächsten die Möglichkeit genommen hier direkt anzusetzen. Wir wissen, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und wir müssen somit gemeinsam entscheiden können, wie und für welche Produkte wir diese einsetzen wollen.
Gibt es bestimmte Projektgruppen (z.B. Kleidung, Bauen, Transport oder Nachwuchs, Konzept, etc.), die Sie in der Regel besonders innovativ oder inspirierend finden? Wenn ja, welche und warum?
Kategorienübergreifend finde ich besonders die Projekte spannend, die ein Umdenken mit sich bringen. Dabei sollte das Projekt auf konzeptioneller Ebene durchdacht sein und technologische, soziokulturelle, politische und wirtschaftliche Aspekte aufgreifen. Als Designerin achte ich natürlich darauf, dass die Gesamtgestaltung schlüssig , ästhetisch und nutzungsfreundlich ist. Und natürlich interessiert mich auch immer besonders die Materialebene, weil das mein Fachgebiet ist.
Erzählen Sie uns von einem Projekt, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist und warum?
Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Projekten habe ich eine Hochachtung vor der Jury, die die finalen Entscheidungen treffen muss. Im Kopf hängen geblieben ist mir jedoch beispielsweise das Gewebe Bananatex der Firma QWSTION und die daraus produzierten Rücksäcke. Aus dem Abfallprodukt der Bananenpflanzen, die ja jedes Jahr neu nachwachsen, ein so hochwertiges Material herzustellen, hat mich beeindruckt. Noch bemerkenswerter fand ich den Schritt, die dafür entwickelte Technologie als Open-Source freizugeben. Dass das entstandene Know-How nicht nur für eigene Zwecke verwendet, sondern weitergegeben wird, schafft auch die schon eben angesprochene Transparenz. Ebenso gut kann ich mich an die Arbeit Baker’s Butchery von Lukas Keller erinnern. Und das nicht nur, weil ich sie betreut habe, sondern auch weil das Konzept für mich durch seine Komplexität herausstach. Es ging vorrangig um die Koppelnutzung von Infrastrukturen, Neben- und Abfallprodukten. Gleichzeitig hinterfragt das Projekt unseren Umgang mit Nahrung. Diese verschiedenen Ebenen sind letztlich in einer sehr gelungen Übersetzung gemündet.
Ein Blick in die Zukunft: Wenn Sie an ökologisches Design denken – wo, in welchen Bereichen oder Branchen, sehen Sie noch am meisten Entwicklungspotenzial?
Nicht nur in einzelnen Branchen, sondern vor allem in der Zusammenarbeit, liegt meiner Meinung nach viel Entwicklungspotenzial. Ich denke es ist ein Irrglaube, die Hoffnung allein in effizientere Technologien zu stecken. Es geht vielmehr um ein Zusammenspiel aus vielen Aspekten bei dem auch unsere Verhaltensmuster und Strukturen mit- und umgedacht werden sollten. Natürlich passiert das schon, aber es fehlt einfach an Geschwindigkeit. Hier nimmt Design eine wichtige Rolle ein, wenn es darum geht, von der Idee in die Umsetzung zu kommen – ob nun Pop-up Radwege oder kleinere regionale Räume in Versuchsräume transformiert werden. Während der Pandemie sehen wir, dass plötzlich viele Dinge ganz schnell mal im experimentellen Rahmen realisiert werden, weil der Anspruch des Gelingens nicht erhoben wurde und die Angst vorm Scheitern in den Hintergrund gerückt ist. Dinge mal auszuprobieren und zu beobachten, wie sie funktionieren, wie sie angenommen werden, überdenken, reflektieren, ändern. Ich glaube diese Geschwindigkeit der Übersetzung in die experimentelle Realität – darin liegt ein echtes Potenzial.
Zum Abschluss: Welchen Rat möchten Sie zukünftigen Teilnehmenden oder Entwicklerinnen und Gestalterinnen von Ecodesign-Projekten mitgeben?
Wie eingangs erwähnt, mutig und ehrlich sein und nicht scheuen, die Komplexität anzunehmen. Natürlich ist manchmal Spezialwissen gefordert, aber es gibt viele wunderbare Personen, die offen sind für Kooperationen. Zum anderen bedeutet Spezialwissen nicht, dass man sich alles aneignen muss, sondern da ist manchmal auch ein Überblick gar nicht schlecht. Ich erlebe unglaublich viele Studierende mit ambitionierten Zielen. Viele sind überaus kritisch und hinterfragend. Das ist großartig, das sollten sie sich unbedingt auch im späteren Berufsleben bewahren.